Jawnuta Overture
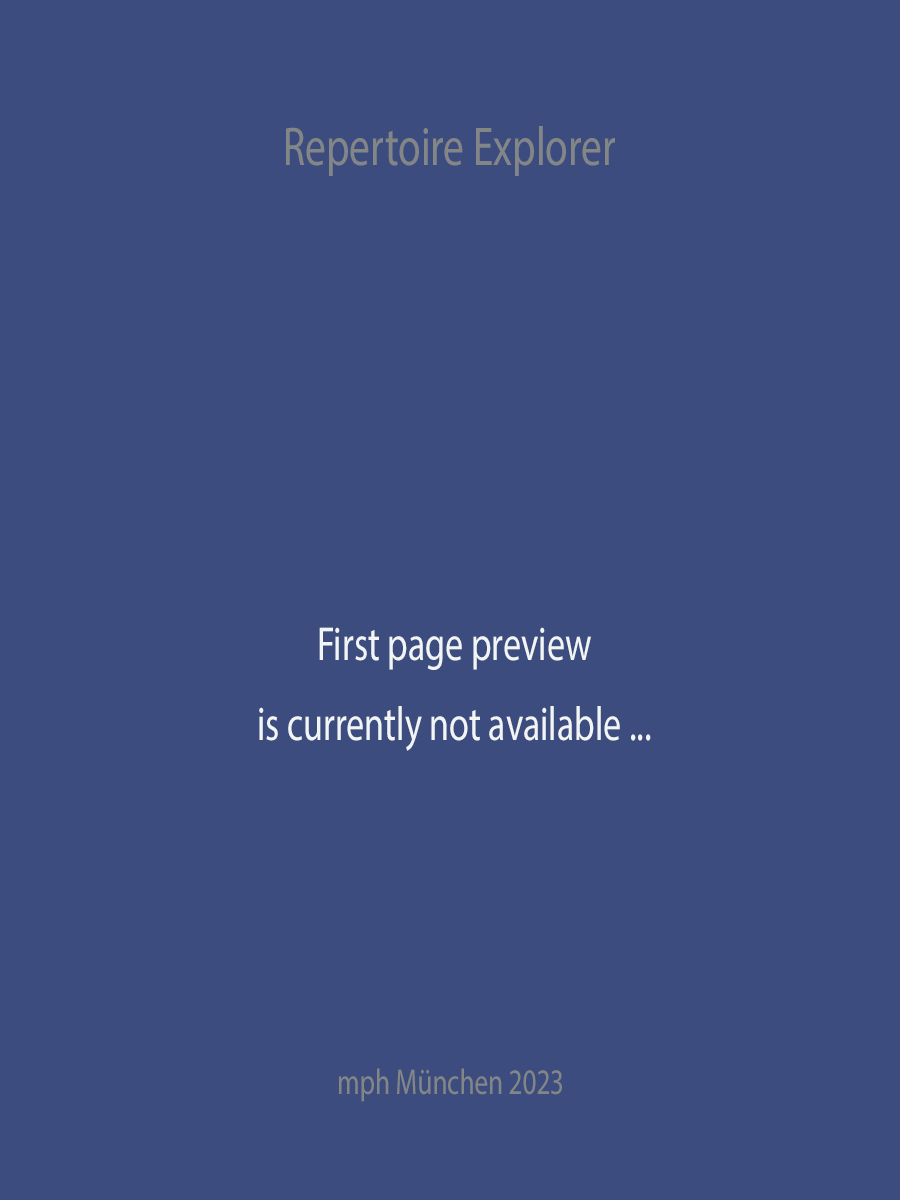
Moniuszko, Stanislaw
17,00 €
Preface
Stanisław Moniuszko
(geb. Ubiel bei Minsk, Weißrussland, 5. Mai 1819 – gest. Warschau, Polen, 4. Juni 1872)
Ouvertüre zur Oper Jawnuta
Besetzung: 2 Fl./Picc. – 2 Ob. – 2 Kl. – 2 Fg. – 4 Hr.- 2 Trp. – 3 Pos., Tb. – Streicher –
Pauke – Schlagwerk
Aufführungsdauer: ca. 5 Minuten
Vorwort der Herausgeberin
Musik zu hören und sie zu verstehen, stellt einen hohen Anspruch an den Hörer – darüber zu sprechen und zu schreiben, fordert Autoren wie Leser zusätzlich auf eine ganz besondere Art und Weise heraus. Denn wie kann und soll es gelingen, über etwas nachzudenken und dies an andere zu vermitteln, das so wenig greifbar ist? Dies trifft generell für Musik und speziell auf Stanisław Moniuszko und seine in Vergessenheit geratenen Werke zu.
Im Wintersemester 2011/2012 entstanden am Musikwissenschaftlichen Institut der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf in dem von mir geleiteten Projekt-Seminar „Schreiben über Musik“ fünf Vorworte zu Opern-Ouvertüren des polnischen Komponsiten: Halka, Flis, Jawnuta, Paria und Verbum Nobile. Die Relevanz solcher Praxiserfahrungen zeigte sich gleich daran, dass (erfreulicherweise) mehr Seminarteilnehmer als zu erarbeitende Vorworte vorhanden waren. So fanden sich Studierende aus geisteswissenschaftlichen wie künstlerischen Studiengängen in Autoren-Teams zusammen, um gemeinsam einen Text zu erarbeiten. Bereits durch diese Konstellation ergab sich eine Gemengelage unterschiedlichster fachlicher und auch persönlicher Voraussetzungen, die zu fruchtbaren Diskussionen führten. Innerhalb regelmäßiger Seminarsitzungen wurden die entstehenden und wachsenden Versionen sowohl in der Gruppe als auch in Einzelbesprechungen durch unterschiedliche Betrachtungs- und Lesemethoden diskutiert, korrigiert und optimiert.
Die ‚Schwierigkeit‘, aber zugleich auch Chance ergab sich in erster Linie aus der dünnen Literaturgrundlage der deutschsprachigen Moniuszko-Forschung. Die Ausgangssituation, mit wenig Vorgegebenem arbeiten zu müssen bzw. zu können, bot die Möglichkeit, die Werke Moniuszkos selbstständig und neu betrachten zu können. So zeigen alle Vorworte völlig unterschiedliche und originelle Ansätze, die überzeugend verdeutlichen, dass sich die Beschäftigung mit Musik jenseits des üblichen „Repertoire-Kanons“ stets lohnt.
Yvonne Wasserloos, Mai 2012
Entstehung des Vorwortes zur Ouvertüre Jawnuta
Recherche ist eine wichtige Komponente beim Verfassen von Texten über einen musikalischen Gegenstand. Es gehört zu den ersten Schritten im Arbeitsprozess, möglichst die gesamte Literatur über den Gegenstand auszuschöpfen, noch bevor man den Text konzipiert. Im Falle des Vorwortes zur Ouvertüre von Jawnuta hat die Recherche wenig Material ergeben, worauf wir uns beziehen konnten. So wurde die Primärquelle – die Partitur – beinah die einzige Grundlage mit der wir arbeiten konnten. Dies zeigte sich im Laufe der Arbeit aber nicht als Behinderung, sondern als Chance unsere Gedanken und Ideen im besonderen Maße auf Papier zu bringen. Im kontinuierlichen Austausch mit allen Beteiligten am Seminar ist unser Vorwort bis zur Vollendung stetig gewachsen. Diese Art des Arbeitens in einer Gruppe und unter Austausch war eine bereichernde Erfahrung.
Teodora Bala-Ciolanescu
Die Hauptschwierigkeit beim Schreiben des Vorworts, aber letztlich auch der Reiz daran lag für mich in der Suche nach dem richtigen „Ton“. Besonders bei der Analyse war darauf zu achten, eine angemessene Sprache zu finden, d.h. eine, die nicht zu wissenschaftlich-trocken, aber trotzdem informativ genug ist. Was noch erschwerend hinzukam, war die Tatsache, dass die eigene Wahrnehmung oft ganz anders war als die der anderen Kursteilnehmer. Gerade deshalb war es aber sehr gut und effektiv, dass die Vorworte immer wieder in der Gruppe diskutiert wurden. Auf diese Weise erhielten wir viele Anregungen, die aus der Distanz sofort nachvollziehbar waren, auf die wir beim Schreiben aber gar nicht gekommen waren. Die Feststellung, dass derselbe Text von verschiedenen Leuten völlig anders gelesen werden kann, war für mich eine interessante Erkenntnis, die für das Schreiben über Musik sicher wichtig ist, da die verschiedenen Sichtweisen hier besonders leicht zu Missverständnissen führen können.
Uta Schmidt
Seit der Entstehung seiner berühmten Oper Halka gilt Stanisław Moniuszko in seinem Heimatland Polen als „Vater der polnischen Nationaloper“. Aufgrund seiner Vorliebe für Vokalmusik komponierte er hauptsächlich zahlreiche Lieder, Operetten und auf dem instrumentalen Feld Ballette. In seinem Gesamtschaffen liegt der Schwerpunkt allerdings mit 14 nachweisbaren Werken auf der Oper. Er entwickelte in seinen Werken eine musikalische Sprache, die für den fast schon verloren geglaubten Nationalstolz Polens von entscheidender Bedeutung war.
Jene nachhaltige Bedeutung äußert sich auch heute noch durch das alljährliche Moniuszko-Festival, das seit 1962 in Kudowa Zdroj stattfindet, und durch den Moniuszko-Vokalwettbewerb am Warschauer Teatr Wielki. Jedoch bleibt sein Ansehen auf internationaler Ebene bis heute auf diese Veranstaltungen beschränkt. Im westeuropäischen Musikleben ist er immer noch relativ unbekannt. Wenn man mehr über ihn erfahren möchte, gestaltet sich die Suche schwierig, denn die europäische, nicht-polnischsprachige musikwissenschaftliche Literatur bietet nur wenig Informationsmaterial. Von den zahlreichen Opern, die Moniuszko komponierte, wurde in erster Linie Halka betrachtet, wesentlich seltener die anderen – und verschwindend gering die 1860 erstmalig aufgeführte Oper Jawnuta. Der Mangel an Informationen zu Jawnuta ist bezeichnend und deutet darauf hin, dass sie von der Zeit ihrer Entstehung bis in die heutige Zeit hinein wenig Beachtung gefunden hat. Wie aber kommt es zu dem Phänomen, dass ausgerechnet diese Oper von der Rezeption so stiefmütterlich behandelt wird? Da auch über die näheren Umstände zur Zeit der Uraufführung keine hinreichenden Informationen vorliegen, bleibt es auf einer weitestgehend hypothetischen Ebene, nach Gründen zu suchen. Daher lohnt es sich, das Werk näher zu betrachten.
Das Libretto basiert auf der Schäferdichtung Die Zigeuner von Franciszek Dionizy Kniaznin (1750-1807). Eine Druckversion existierte seit 1828, das Epos wurde bereits zuvor im Theater aufgeführt. Moniuszko verwendete den Text später zunächst als Stoff für eine gleichnamige Operette, die 1852 in Vilnius uraufgeführt wurde. Einige Jahre später entschied sich der Komponist dafür, den Inhalt zu einer zweiaktigen Oper auszubauen, die unter dem Titel Jawnuta erschien. Das Libretto schrieb Wladysław Ludwik Anczyc (1823-1883), die Uraufführung fand am 5. Juni 1860 in Warschau statt.
Inhaltlich geht es in der Oper um die konfliktreiche Liebesgeschichte von Stach und Chicha, die in ungleichen gesellschaftlichen Verhältnissen aufwuchsen. Stach ist der Sohn des Vogts, Chicha ein „Zigeuner“mädchen. Weil der Vogt, der starke Vorurteile gegen „Zigeuner“ hegt und sie als „diebisches Volk“ bezeichnet, die Beziehung missbilligt, überredet Stach seine Geliebte zur Flucht. Sie schwankt jedoch zwischen ihrer Liebe zu ihm und jener zu ihrer Mutter Jawnuta, die sie nicht alleine zurücklassen will. Jawnuta erfährt zu einem späteren Zeitpunkt von Jewa, einer älteren Dorfbewohnerin, dass deren zwei Kinder vor langer Zeit verschwanden und nicht mehr gesehen wurden. Jawnuta erkennt, dass ihre Tochter Chicha und ihr Sohn Dzega in Wirklichkeit Jewas Kinder sind, die sie selbst damals aus Mitleid bei sich aufgenommen und wie ihre eigenen behandelt hatte, und klärt daraufhin die Situation auf. Chicha und Dzega sind demnach keine „Zigeuner“, sondern die Kinder der Dorfbewohner Szymon und Jewa. Der Heirat zwischen Stach und Chicha steht daher nichts mehr im Wege. Auch der Vogt erkennt, dass seine Vorurteile gegenüber “Zigeunern“ unbegründet waren.
Die Hauptsujets – Liebe, Vorurteile, gesellschaftliche Ungleichheiten, Missverständnisse – sind zwar bei weitem nicht neu für einen Opernplot und auch die überraschende versöhnliche Schlusswendung wirkt nicht besonders originell. Wenn dies jedoch für den Erfolg einer Oper ausschlaggebend wäre, hätte so manch andere Oper beim Publikum durchfallen müssen, die heute weltberühmt ist. Ebenso weit hergeholt erscheint beispielsweise die wundersame Auflösung in Wolfgang Amadeus Mozarts Le nozze di Figaro, dass Marcella eigentlich Figaros Mutter ist und er sie deshalb nicht heiraten kann! Darüber hinaus ist auch der Inhalt der Oper Halka jenem der Jawnuta und auch weiteren Opern Moniuszkos, die mehr Ansehen genossen haben, nicht unähnlich. Neben dem allgemeinen Thema Liebe wird häufig Gesellschaftskritik geäußert. Da Polen sich zu jener Zeit unter Fremdherrschaft Preußens, Russlands und Österreichs befand und somit kein souveräner Nationalstaat mehr war, entstand das Bedürfnis, ein nationales Bewusstsein aufzubauen, das der politischen Lage entgegenwirken sollte. Dieses sollte durch den Zusammenhalt aller gesellschaftlichen Schichten entstehen, wofür sich das Volk zuständig fühlte. Somit dürfte ein Sujet wie in Jawnuta, was die Forderung nach einem Zusammenhalt unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichten betrifft, beim Publikum auf Interesse gestoßen sein. Inhaltlich gesehen lässt demzufolge nichts auf eine minderwertige Qualität schließen, die ein solches Desinteresse an dieser Oper erklären würde.
Wenden wir uns daher der Ouvertüre selbst zu. Es handelt sich um ein sehr kurzweiliges Werk von etwa fünf Minuten Länge, das geprägt ist von volkstümlichen Melodien. Dank der eingängigen und verständlichen Kompositionsweise sowie des frischen Tempos (Allegro vivace) wirkt die Musik höchst unterhaltsam und lebendig. Auch unabhängig vom Text und Inhalt der Oper erwartet den Hörer ein zwar kurzes, aber doch eigenständiges sinfonisches Werk. Moniuszko stellt in dieser Ouvertüre u.a. seine Fähigkeiten einer farbenreichen Instrumentierung unter Beweis, indem er Tutti-Abschnitte und kammermusikalische Episoden abwechselnd gegenüberstellt und in besonderer Weise auch Schlaginstrumente wie Tamburin, Große und Kleine Trommel, Becken und Triangel mit einbezieht. Dieses klangliche Element sorgt neben dem volkstümlichen und rhythmisch betonten Duktus der Themen für den typischen Charakter, der hierzulande meist stereotyp mit osteuropäischer Musik assoziiert wird.
Im Vordergrund stehen zwei Themen. Diese sind über den gesamten Verlauf der Ouvertüre stets präsent, wobei sie sich in ihrem Auftreten abwechseln. Ohne Einleitung wird das Werk mit dem ersten Thema eröffnet. Es steht in der Tonika d-Moll und ist markant rhythmisiert, erkennbar schon an den eröffnenden akzentuierten Halben im alla breve-Takt. Das 12-taktige Thema beginnt fanfarenartig im Tutti, es basiert anfangs auf dem Tonikadreiklang. Ab Ziffer 1 wird das Geschehen rhythmisch aufgelockert, da auch die Begleitinstrumente neben den statischen Akkordschlägen nun in fließendere Skalenbewegung übergehen. Auffällig ist, dass dieses erste Thema große Ähnlichkeit mit dem Krakowiak aufweist, einem beliebten polnischen Nationaltanz, den Moniuszko im Gegensatz zur Polonaise nur für die unteren gesellschaftlichen Schichten einsetzt. Da es in der Oper einerseits um „Zigeuner“, andererseits um einfache Bauern geht, kann die Verwendung des Tanzes dieser Figurengruppe zugeordnet werden.
Das zweite Thema (Ziffer 7) in der Tonikaparallele F-Dur bildet den erwarteten Kontrast zu seinem Vorgänger. Im Gegensatz zum ersten Thema, das meist im Orchestertutti erklingt, ist es vorrangig kammermusikalisch bzw. solistisch besetzt. Das rhythmische Element tritt in den Hintergrund. Stattdessen legt Moniuszko hier Wert auf melodische Linien und Kantabilität, erkennbar an dem bevorzugten Gebrauch von Sekund- und Terzschritten. Auch in seinem Charakter unterscheidet es sich deutlich vom Eröffnungsthema. Während jenes durch seine teils starre, teils energisch vorwärts drängende Rhythmik eine gewisse Strenge erkennen lässt, finden sich hier Elemente, die Assoziationen von Salonmusik hervorrufen. Hierzu gehören z.B. die auch aus dem Genre der Unterhaltungsmusik bekannten Terzparallelen, die Moniuszko an dieser Stelle im Duett der ersten beiden Violinen verwendet. Durch die besondere Bevorzugung der Begleitinstrumente Tamburin und Triangel gelingt es dem Komponisten darüber hinaus, auch den Aspekt des Volkstümlichen hervorzuheben. Erwähnenswert ist ebenso der theatralisch wirkende Septakkord (Ziffer 7), durch den die Grundtonart des Themas erreicht wird. Hier zeigt sich ein szenisches bzw. gestisches Element, das bereits deutlich auf die Dramatik des nachfolgenden Operngeschehens verweist. Die harmonische und melodische Verarbeitung der Themen stellen somit dank ihrer Eingängigkeit und instrumentalen Farbigkeit ein höchst kurzweiliges Hörvergnügen dar. Die Ouvertüre vermittelt daher eine ungetrübt fröhliche und lebendige Stimmung.
Lediglich zwei kurze Passagen sind es, die aus dem Gesamtbild herausstechen: Nachdem Moniuszko die Themen zunächst konsequent abwechselnd in den Vordergrundstellt, erscheint in Ziffer 14 erstmalig ein Abschnitt, in dem weder das eine noch das andere Thema zu hören ist. Mehr noch – dieser Abschnitt scheint überhaupt nicht thematisch geprägt zu sein. Stattdessen fühlt sich der Hörer auf einmal in eine völlig andere Welt versetzt, die mit dem bisherigen musikalischen Geschehen nichts gemeinsam hat. An dieser Stelle bricht das zuvor so vielfältige musikalische Geschehen unvermittelt ab und wird auf Chromatik, melodische Kleinstschrittigkeit und Halteklänge reduziert. Statt des vollen Orchesterklangs ertönen Sekundpendelbewegungen in den Streichern, die Moniuszko hier komplett unisono spielen lässt. Die gelegentlichen chromatischen Einwürfe der Holzbläser hinterlassen zusammen mit dem zurückgehaltenen piano und der bevorzugten Verwendung von Halteklängen in der Begleitung einen regelrecht bedrohlichen Charakter. Alles, was zuvor noch einen so hohen Grad an melodischer Prägnanz und Eingängigkeit ausgestrahlt hatte, ist hier verschwunden. Erst in Ziffer 16 taucht das zweite Thema in den Flöten wieder auf. Durch die ungewöhnliche Begleitung, die nach wie vor aus einem einzigen Halteton a in den tiefen Streichern besteht, erhält es hier jedoch einen völlig anderen Charakter als zuvor.
Die zweite bemerkenswerte Passage erscheint nach einem groß angelegten Spannungsbogen zwischen Ziffer 20 und Ziffer 23, bei dem der Hörer eigentlich schon den Schluss der Ouvertüre vermutet. Hier reißt das musikalische Geschehen erneut abrupt ab. Nach einer mehrtaktigen Generalpause ertönt ein letztes Mal das zweite Thema – diesmal in der Solovioline, begleitet von Halteakkorden der tiefen Streicher, und erneut mit einer Verfremdung der vertrauten Melodie. Diese beginnt zwar wie gewohnt, schließt jedoch statt mit dem zu erwartenden cis mit einem tief alterierten c. Auf diese Weise wird eine Moll-Atmosphäre heraufbeschworen, die durch eine vorher nie aufgetauchte Seufzermotivik zusätzlich intensiviert wird, wodurch ein völlig neuer und unerwarteter Klangcharakter entsteht. Eine mögliche Interpretation dieser Passage wäre, dass Moniuszko die bürgerliche Sphäre der handelnden Figuren durch den salonhaften Duktus des zweiten Themas kritisieren will und es daher geringfügig, aber hörbar verfremdet und dadurch sozusagen mit musikalischen Mitteln ironisiert. Bezeichnenderweise wird nur das zweite Thema derart ‚entstellt‘, während das erste, abgesehen von der unterschiedlichen Harmonisierung, im Charakter weitestgehend unverändert bleibt. Auch die unterschiedlichen Tempi, die Moniuszko für das zweite Thema benutzt, sind hier für einen interessanten Effekt verantwortlich, denn im schnellen Tempo wirkt die Melodie bereits viel herausfordernder und energischer als im langsamen, das eher einen schwelgenden, entspannten Charakter vermittelt.
Die musikalischen Elemente, die Moniuszkos Werk zu einer nationalen Musik machten und damit dem Wunsch der Polen entsprachen, sind auch in dieser Ouvertüre wieder zu finden. In eine Musik, die in Form und Besetzung nach den allgemeingültigen Konventionen der europäischen Kunstmusik komponiert wurde, wird hier der Volkstanz Krakowiak integriert. Jener Tanz hat einen symbolischen Charakter, da er an frühere Zeiten erinnert und das idealisierte Bild der Urkultur des einstigen polnisch-litauischen Reichs darstellt. Dieses bildet einen Kontrast zum damals aufgeteilten Gebiet – ein politischer Staat existierte nicht mehr, die Idee der Nation lebte jedoch fort. Ebenso bieten die Klarheit der Form und die Eingängigkeit der Melodik dieser Ouvertüre eine allgemeine Greifbarkeit, die das Werk zugänglich und verständlich macht und damit eine weitere volkstümliche Komponente bildet. Die Integration von Volkstänzen und Eingängigkeit der Musik waren nicht neu bei Moniuszko, aber dennoch beim polnischen Opernpublikum dieser Zeit sehr beliebt. Was den nationalen Charakter angeht, dürfte das Werk aus diesem Grund weder enttäuscht noch verblüfft, sondern vielmehr erneut die Identität Polens klanglich heraufbeschworen haben.
Die wahrscheinlichste Antwort auf die eingangs gestellte Frage, warum die Oper derart wenig Ansehen genoss, findet sich weder im Libretto noch in der Partitur. Jawnuta gilt möglicherweise deshalb nicht als eines der Hauptwerke von Moniuszko, da es eine Bearbeitung des schon früher erschienen Werks Die Zigeuner ist. Während seiner Zeit als künstlerischer Leiter an der Warschauer Oper führte der Komponist neben seinen Hauptwerken (z.B. Halka und Straszny dwór) auch seine Überarbeitungen früher komponierter Werke zum ersten Mal auf. Dazu zählen beispielsweise Widma, Milda und auch Jawnuta. Nachdem Moniuszko sich in Polen schon einen Namen als Nationalkomponist gemacht hatte, war es vermutlich schwieriger, ihn voll und ganz für ein Werk zu feiern, das nur als Überarbeitung galt, auch wenn es den typischen und beliebten Stil Moniuszkos enthielt. Da der Komponist im Ausland relativ unbekannt war, dürfte sich die internationale Presse auf die Aufführungen seiner populäreren Opern konzentriert und die anderen Werke außer Acht gelassen haben.
Dies ist sicherlich nur eine von vielen Interpretationsmöglichkeiten, die sich angesichts des mangelnden Informationsmaterials ergeben. Grundsätzlich jedoch handelt es sich hier um eine Ouvertüre, die es, auch losgelöst vom damaligen politischen Kontext, verdient, wieder entdeckt zu werden und der eine größere Beachtung geschenkt werden sollte. So könnte ein heutzutage gängiges Konzertprogramm, das beispielsweise aus einer Sinfonie im zweiten Teil und einem Solokonzert im ersten Teil besteht, durch diese kurze Ouvertüre als Auftakt sicherlich zusätzlich bereichert werden. Auch ohne die anschließende Oper stellt sie zweifellos eine eigenständige und ernst zu nehmende Musik dar, der aus diesem Grund die entsprechende Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zuteil werden sollte.
Teodora Bala-Ciolanescu, Uta Schmidt, März 2012
Aufführungsmaterial ist von PWM, Krakau zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars der Musikabteilung der Leipziger Städtischen Bibliotheken, Leipzig.
Editor’s Preface
If listening to and understanding music places high demands on the listener, speaking and writing about it poses further quite special challenges to writers and readers alike. How is it possible or feasible to think about something so intangible and to convey it to other people? This question applies not only to music in general, but especially to Stanislaw Moniuszko and his forgotten works.
In the 2011-12 winter semester, I held a seminar on “Writing about Music” at the Musicological Institute of Robert Schumann University in Düsseldorf. The result was five prefaces to opera overtures by Moniuszko: Halka, Flis, Jawnuta, Paria, and Verbum Nobile. The relevance of such practical experience became immediately apparent in that, happily, there were more seminar members than prefaces to be written. As a result, students from the arts and humanities formed teams to write joint essays. The combinations produced a very broad and varied array of intellectual and personal prerequisites, which led to productive discussions. During the regular seminar sessions, the emerging and expanding versions were debated, altered, and optimized both within the group and in individual discussions using various approaches and methods of reading.
One primary “difficulty,” and at the same time an opportunity, was the paucity of scholarly writings on Moniuszko in German. The ability and necessity of proceeding more or less from scratch made it possible to view his works with a fresh and independent eye. As a result, all the prefaces represent wholly different and original approaches, convincingly demonstrating that the study of music outside the standard “canon” is always worth the effort.
Yvonne Wasserloos, May 2012
Writing the Preface to the Jawnuta Overture
Research is a major component when writing about music. One the first steps in the working process is to cover, wherever possible, all the literature on the subject in question before conceiving the text. In the case of the preface to the Jawnuta Overture, our research turned up very little material to which we could refer. As a result, practically the only foundation we could build on was the primary source: the score. As we proceeded, however, this proved to be not so much an obstacle as an opportunity to focus on our own thoughts and ideas. Our preface grew constantly toward completion in a continuous interchange with every member of the seminar. This type of group effort and intellectual exchange was an enriching experience.
Teodora Bala-Ciolanescu
For me, the main difficulty in writing this preface, but also its special fascination, lay in finding the right “inflection.” Particularly in the analysis, I had to take pains to find appropriate wording – not overly arid and academic, yet sufficiently informative. A further complication was ‘that my own perceptions often differed radically from those of the other members of the seminar. But for this very reason it proved very good and effective to discuss the prefaces repeatedly in the group. In this way we received many suggestions that were immediately convincing from a distance but had escaped us entirely while writing. For me, the discovery that the same text can be read in completely different ways by different people was an interesting insight that is surely relevant to writing about music, where conflicting viewpoints can lead especially easily to misunderstandings.
Uta Schmidt
Stanisław Moniuszko
(b. Ubiel nr. Minsk, 5 May 1819 – d. Warsaw, 4 June 1872)
Overture to the Opera Jawnuta
Instrumentation: 2 fl (pic), 2 ob, 2 cl, 2 bn, 4 hn, 2 tpt, 3 tbn, tuba, strs, timp, perc
Duration: ca. 5 min.
Ever since the birth of his famous opera Halka, Stanisław Moniuszko has been considered the “father of Polish national opera” in his native Poland. His preference for vocal music caused him mainly to write a large number of songs, operettas, and, in instrumental music, ballets. But the main focus of his oeuvre falls on his fourteen known operas. He developed a musical idiom that became of seminal importance to Poland’s seemingly lost national pride.
Today his lasting importance finds expression in the annual Moniuszko Festival, held in Kudowa Zdroj since 1962, and in the Moniuszko Vocal Competition held in Warsaw’s Teatr Wielki. But to the present day his international acclaim has remained limited to these two events. He is still relatively unknown in the musical life of Western Europe. Attempts to learn more about him prove difficult, for little information on him is to be found in the non-Polish scholarly literature. Of the many operas he wrote, attention falls mainly on Halka, much less on the others, and almost none at all on Jawnuta, premièred in 1860. The lack of information on Jawnuta is highly revealing, suggesting that it has received scant recognition from the time of its composition to the present day. How did it come to pass that this opera in particular has been treated in such a miserly fashion by posterity? As we know too little about the circumstances surrounding its première, the answer is largely a matter of guesswork. It is thus worth taking a closer look at the opera itself.
The libretto is based on the pastoral poem Die Zigeuner (“The Gypsies”) by Franciszek Dionizy Kniaznin (1750-1807). This epic poem had been in print since 1828 and had already been presented on stage. Later Moniuszko used it as material for a like-named operetta, Cyganie, that was premièred in Vilnius in 1852. Still latter he decided to expand the material into a two-act opera, to which he gave the title Jawnuta. The libretto was written by Wladysław Ludwik Anczyc (1823-1883); the première took place in Warsaw on 5 June 1860.
The opera deals with the tortuous love story of Stach and Chicha, who grew up in unequal social surroundings. Stach is the son of the Bailiff, Chicha a “gypsy girl.” The Bailiff has strong prejudices against “gypsies,” whom he regards as a “pack of thieves,” and disapproves of the relationship. Stach persuades his lover to elope, but she is torn between her love for him and her love for her mother Jawnuta, whom she does not want to leave behind. Later Jawnuta learns from Jewa, an elderly village woman, that Jewa’s two children vanished long ago and have never been seen since. Jawnuta realizes that her daughter Chicha and her son Dzega are in fact Jewa’s children, whom she had taken in out of pity and raised as her own. She explains the new situation: Chicha and Dzega are not “gypsies” but children of the villagers Szymon and Jewa. The obstacles to their marriage vanish, and even the Bailiff realizes that his prejudices against “gypsies” were unfounded.
To be sure, the main themes – love, prejudice, social inequality, misunderstandings – are nothing new in an opera plot; nor is the surprising final reconciliation particularly original. But if an opera’s success turned on these factors alone, many a world-famous opera of today would fail with the public. No less far-fetched is, for example, the wondrous turn of events in Mozart’s Marriage of Figaro, where Marcellina proves to be Figaro’s mother, preventing him from having to marry her! Moreover, the plot of Halka is not dissimilar to that of Jawnuta or Moniuszko’s other operas which have enjoyed greater acclaim. Besides the general theme of love, they frequently express a critique of society. As Poland was then ruled by the foreign powers Prussia, Russia, and Austria, and was thus no longer a sovereign nation-state, the need arose to develop a national awareness capable of counterbalancing the political situation. This awareness was meant to arise through the cohesion of all strata of society, for which the entire nation was to feel responsibility. In this light, the theme of Jawnuta – the appeal for solidarity among unequal social strata – probably met with interest from the audience. There is nothing inferior about the opera’s plot, then, to explain why this interest failed to materialize.
Let us turn to the overture, a very entertaining work of five-minutes’ duration dominated by folk-like melodies. Thanks to its ingratiating and accessible compositional style and its brisk tempo (Allegro vivace), the music is lively and diverting. Regardless of the words and plot of the opera, the listener is treated to a brief but self-sufficient piece of symphonic music. In this overture Moniuszko displays, among other things, proof of his skills at colorful orchestration by contrasting tutti sections with chamber-like episodes and deftly interspersing such percussion instruments as tambourine, bass drum, side drum, cymbals, and triangle. Besides the folk-like and rhythmic themes, this timbral element projects a character typically associated, in our climes, with the music of Eastern Europe.
Two themes come to the fore and remain present, in alternation, throughout the entire overture. The work opens without an introduction, plunging directly into the first theme. It is set in the tonic D minor and given a striking rhythmic guise, as is already manifest in the opening accented half-note in alla breve meter. The twelve-bar theme begins like a tutti fanfare initially based on a tonic triad. At rehearsal number 1, the music begins to relax as the accompanying instruments enter a more flowing scalar motion alongside static chordal hammerblows. This first theme conspicuously resembles a krakowiak, a popular Polish folk dance that Moniuszko uses solely for the lower rungs of society, in contrast to the polonaise. As the opera deals with “gypsies” and simple peasant folk, the use of this dance can be attributed to this group of characters.
The second theme (rehearsal no. 7), set in the relative key of F major, forms the expected contrast to its predecessor. Unlike the first theme, which is given mostly to the orchestral tutti, it is scored mainly for solo instruments or chamber ensemble. The rhythmic element recedes into the background. In its stead, Moniuszko emphasizes tuneful melody, as can be seen in his preference for melodic 2nds and 3rds. It also differs markedly in character from the opening theme, whose propulsive rhythm, now static, now energetic, projects a certain degree of rigor, while the second theme has elements redolent of salon music. Among these elements are the parallel 3rds familiar from light music, here used in the duet between the first two violins. The special preference for tambourine and triangle in the accompaniment also allows the composer to bring out the folk-like flavor. Equally worthy of mention is the seemingly theatrical 7th chord (rehearsal no. 7) that restores the theme to the tonic – a dramatic and gestural element clearly anticipating the events of the opera to follow. Owing to their catchiness and colorful orchestration, the harmonic and melodic elaboration of these themes is highly entertaining. The overture projects a mood of unclouded vitality and merriment.
Only two brief passages stand out from this overall picture. At rehearsal number 14, after Moniuszko has consistently placed the themes alternately in the foreground, we hear, for the first time, a section associated with neither theme. Indeed, it seems to have no thematic basis at all. Instead, the listener is transported into a completely different world that has nothing in common with the preceding music. Here the varied musical events come abruptly to a halt and are reduced to chromaticism, sustained sonorities, and melodies with the narrowest of intervals. Instead of a full orchestral sound, we hear oscillating 2nds in the strings, which are made to play entirely in unison. The occasional chromatic interjections from the woodwinds, as well as the subdued piano and the emphasis on sustained sonorities in the accompaniment, convey a sense of impending danger. Everything that had radiated such trenchant melody and tunefulness up to now suddenly vanishes. Not until rehearsal no. 16 does the second theme return in the flutes. But it is now given a completely different character by the unusual accompaniment, consisting, as ever, of a single sustained A in the low strings.
The second remarkable passage appears at the end of a large-scale arch between rehearsal numbers 20 and 23, when the listener already expects the overture to come to an end. Once again the musical events come to an abrupt stop. After a general pause lasting several bars, we hear one final recurrence of the second theme, this time in the solo violin accompanied by sustained chords in the low strings, with the now familiar melody once again distorted. It begins as before, but instead of the expected C# it ends with an altered C♮. In this way Moniuszko conjures up a minore atmosphere intensified by previously unheard “sigh” motifs, lending the music a wholly new and unexpected sound. One way of interpreting this passage is that Moniuszko, wishing to criticize the opera’s bourgeois characters with the salon-like flavor of the second theme, now distorts it, minimally but audibly, in order to cast it in an ironic light. Revealingly, only the second theme is “disfigured” in this way, whereas the first, apart from its contrasting harmonizations, basically retains its original character. Even the contrasting tempos that Moniuszko uses for the second theme likewise create an interesting effect here: the fast tempo makes the melody sound much more defiant and energetic than it had been at the slow tempo, which conveyed a sense of indulgence and relaxation.
The musical elements that turned Moniuszko’s output into a national music meeting the needs of the Polish nation can also be found in the overture. Here a krakowiak is interpolated into music which, in form and scoring, follows the standard conventions of European art music. This folk dance functions as a symbol, for it recalls earlier times and represents an idealized image of the indigenous culture of the former Polish-Lithuanian Union. The Union in turn forms a contrast with the partitioned Poland of the time: there was no longer a Polish state, although the idea of the Polish nation continued to thrive. Similarly, the overture’s formal clarity and the ingratiating melodies provide a general tangibility that makes it accessible and intelligible, thereby forming another folk-like component. Moniuszko was not the first composer to adopt folk dances and catchy tunes, but they were very popular with Polish opera-goers at the time. As far as national character went, the work was probably neither disappointing nor puzzling, but evoked Poland’s identity once again in sound.
Thus, the most likely answer to the question we posed at the beginning – why the opera has received such little acclaim – is to be found neither in the libretto nor in the score. The reason why Jawnuta is not numbered among Moniuszko’s major achievements is that it happens to be an adaptation of his earlier work, Cyganie. During his tenure as artistic director of the Warsaw Opera, Moniuszko not only presented his major works (e.g. Halka and Straszny dwór), he also premièred revisions of works he had written earlier, including Widma, Milda, and the present Jawnuta. Having made a name for himself in Poland as a national composer, it was presumably more difficult to praise him wholeheartedly for a work that amounted to little more than an overhaul, even if couched in his typical popular style. As he was relatively unknown outside Poland, the foreign press probably focused on performances of his popular operas and ignored the others.
This is surely only one of many possible interpretations of the scant information available. In principle, however, this overture, when extracted from the political context of its time, is fully deserving of rediscovery and greater recognition. A standard concert program of today, with a symphony in the second half and a concerto in the first, would surely profit from starting off with this short piece. Even without its attendant opera it unquestionably represents a self-sufficient and worthy piece of music which, for this reason, duly merits public attention.
Translation: Bradford Robinson
For performance material please contact the publisher PWM, Krakow. Reprint of a copy from the Musikabteilung der Leipziger Städtischen Bibliotheken, Leipzig.
Score Data
| Edition | Repertoire Explorer |
|---|---|
| Genre | Ouverture |
| Seiten | 44 |
| Format | 210 x 297 mm |
| Druck | Reprint |