Quintette en ré mineur pour flûte, hautbois, clarinette, basson et piano op. 8 (score and parts)
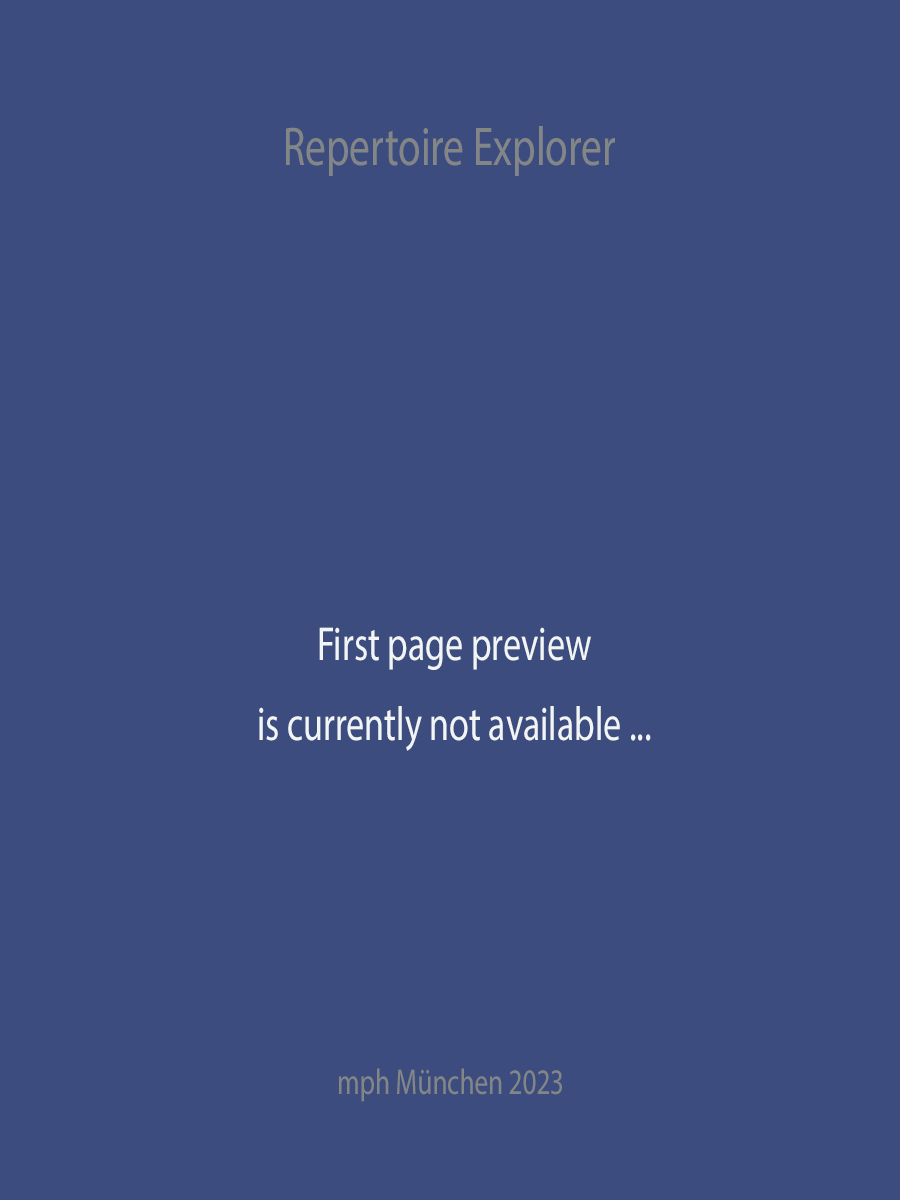
Magnard, Albéric
31,00 €
Preface
Magnard, Albéric
Quintette en ré mineur pour flûte, hautbois, clarinette, basson et piano op. 8
(score and parts)
The score is introduced with a scholarly preface (English and German) and the preface is available online for inspection. All this is made possible by a worldwide network of musicians, musicologists and music-loving amateurs who contribute to the series in many different ways.
At the end of the preface you find a reference to the music publisher providing performance materials. In case we provide the performance materials you find a note under the additional information tab.
Read preface / Vorwort > HERE
Score Data
| Edition | Repertoire Explorer |
|---|---|
| Genre | Kammermusik |
| Seiten | 128 |
| Printing | Reprint |
| Specifics | Set Score & Parts |
| Size | 225 x 320 mm |